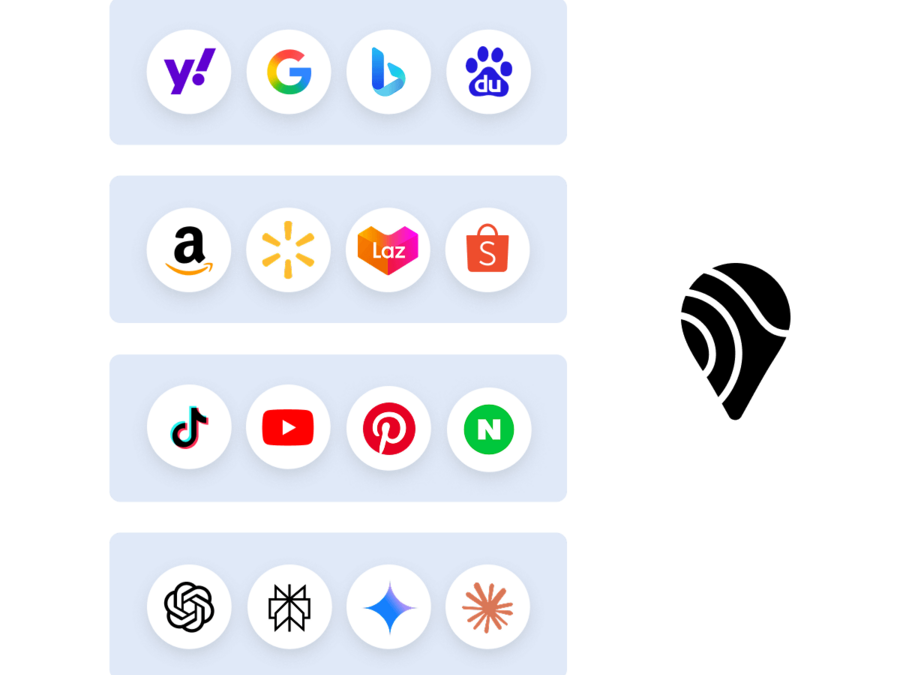Schätzungen zufolge könnte die Krise den Haushalt von Bund und Ländern im Jahr 2020 insgesamt bis zu 1,3 Billionen Euro gekostet haben. Darin eingerechnet sind allerdings auch Kreditgarantien in Höhe von knapp 830 Millionen Euro, wobei nicht klar ist, in welcher Höhe sie tatsächlich fällig werden. Auch erwartete Einnahmeausfälle durch weniger Steuern sind berücksichtigt. Berechnungen für das Jahr 2021 gehen von 184 Milliarden Euro Corona-Folgekosten aus, wobei auch hier nicht feststeht, wie hoch der Betrag für in Anspruch genommene Hilfen real ausfallen wird. Insgesamt, so hat das Finanzministerium ausgerechnet, hat der Bund für das Jahr 2020 rund 397,1 Milliarden Euro bereitgestellt, während Länder und Kommunen rund 82,8 Milliarden zahlten. 27 Milliarden wurden von den Sozialkassen getragen, davon 25,5 Milliarden für Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld.
Drei Millionen Antragsberechtigte
In diesem Zeitraum war der zweite Lockdown allerdings noch nicht Realität. Und der kostet ebenfalls. Nach wie vor ist nicht klar, ob diese Summe, also 184 Milliarden Euro für 2021, ausreichen wird. Insgesamt gibt es rund drei Millionen Antragsberechtigte, Menschen also, die einen Anspruch auf Wirtschaftshilfen während der Pandemie haben. Fraglich ist, wie der enormen Verschuldung, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist, Herr zu werden ist. Hinzu kommt, dass sich das Kaufverhalten von Kunden während der Pandemie verändert hat und niemand sagen kann, wie sich dieses in Zukunft gestaltet. Nicht wenige Experten vertreten die Auffassung, dass die finanzielle Schieflage, in die die Öffentliche Hand durch die Coronapandemie zunehmend gerät, nur durch eine Anhebung der Steuern beseitigt werden kann.
Fratzscher: Vermögen höher besteuern, Arbeitseinkommen entlasten
Dieser Meinung ist zum Beispiel Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der notwendigen Gegenfinanzierung der auflaufenden Pandemieschulden sowie wegen der darüber hinaus unabweisbar fälligen Investitionen für Klimaschutz und Digitalisierung glaubt Fratzscher, dass die Finanzierung nicht ohne Steuererhöhungen gelingen werde. Sein Vorschlag für den Weg aus der Finanzmisere: Höhere Steuern auf Vermögen und eine Entlastung des Arbeitseinkommens. Allerdings wendet er sich gegen die Erhöhung der Vermögenssteuer. Fratzscher favorisiert stattdessen die Erhöhung von Abgaben auf Grund und Boden sowie substantielle Änderungen bei der Erbschaftssteuer. Sein Kollege, DIW-Mitarbeiter Professor Viktor Steiner, sieht das ähnlich. Er geht davon aus, dass es nach der Bundestagswahl zu Steuererhöhungen kommen wird. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zum Beispiel sieht er kritisch, weil wir ja bereits vor kurzem einen dreiprozentigen Schritt hatten.
Städte und Kommunen stellen bereits Steuererhöhungen in Aussicht
Auch wenn sich im Superwahljahr 2021 darauf kein Politiker festlegen lassen will: Viele Städte Gemeinden in Deutschland haben – teilweise coronabedingt – bereits in Aussicht gestellt, die Grundsteuer B zu erhöhen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. In Kerpen zum Beispiel gilt das für die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Ähnlich wie im nordrheinwestfälischen Alfter: Hier wird neben der Grundsteuer A und B außerdem die Gewerbesteuer angehoben. Auch im niedersächsischen Liebenau deuten für die Jahre 2022 bis 2024 auf Erhöhungen der Grundsteuer A und B. Andererseits, so die Kalkulation, würde der Haushalt in die roten Zahlen rutschen. Die Gewerbesteuer soll zumindest dort zunächst außen vor bleiben. Gleichzeitig führt die derzeitige Krise zu einem massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer, die die wichtigste Einnahmequelle der Städte und Gemeinden darstellt. Diese drei Beispiele dürften stellvertretend für zahlreiche Kommunen stehen, die nicht den Vorteil haben, durch ihre Randlage zu größeren Städten Nutznießer von deren Infrastruktur zu sein und somit finanziell vergleichsweise gut über die Runden zu kommen. Für Landkreise und Kommunen gilt: In der Fläche wird es finanziell enger. Vielfach hilft dann tatsächlich nur noch, die öffentlichen Leistungen herunterzufahren, Bibliotheken und Schwimmbäder zu schließen. Gleichzeitig bleibt Kommunen, die kein starkes Wirtschaftsunternehmen am Ort haben, von dessen Gewerbesteuer der Gemeindehaushalt profitieren könnte, Dienstleistungen wie Müllabfuhr und anderes deutlich zu verteuern.
Studie: Zwei Drittel der der Städte und Gemeinden wollen Steuern erhöhen
Nach der „Kommunenstudie 2020/21“ des Beratungsunternehmens EY wollen zwei Drittel der Befragten Städte und Gemeinden Abgaben und Steuern erhöhen. Grund seien die zu erwartenden sinkenden Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben und einer daraus resultierenden wachsenden Kreditaufnahme. Die „Kommunenstudie” beruht auf einer Umfrage unter 300 deutschen Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern im November. Flankiert wird diese Entwicklung der Studie zufolge durch Leistungsabstriche. Rund ein Viertel der Kommunen hätten bereits bürgernahe Leistungen gekürzt oder planen entsprechende Schritte. Die Autoren der EY-Studie gehen davon aus, dass die Städte und Gemeinden zunächst finanziell relativ unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen sind. Sie führen das auf die umfänglichen Finanzhilfen des Bundes und der Länder zurück. Diese Hilfen hätten der Studie zufolge rund zehn Prozent der kommunalen Einnahmen ausgemacht, während die Gewerbesteuer im Schnitt um 15 Prozent zurückgegangen sei. Dennoch geht die Studie davon aus, dass die Pandemie die Kommunen finanziell um Jahre zurückgeworfen hat. Viele von ihnen fürchten, die daraus resultierende Verschuldung nicht aus eigener Kraft zurückführen zu können.
Vermögenssteuer im Gespräch
Hilfebedarf ist also das vorherrschende Signal in Richtung Bund und Länder. Bundesfinanzminister Scholz will nicht nur Personen mit hohem Einkommen und Vermögende zu höheren Steuern heranziehen, sondern spricht sich auch für die Einführung einer Vermögenssteuer aus. Diese soll unter anderem dazu dienen, den Ländern und Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen. Mit der Anhebung der Steuern für Vermögende sollen die milliardenschweren Corona-Hilfen, eventuell auch die der kommenden Jahre, wenigstens zum Teil ausgeglichen werden. FDP-Chef Christian Lindner sieht das eher skeptisch. Die Umsetzung des Plans wird nach seiner Einschätzung weniger die Millionäre als vielmehr Millionen Beschäftigte im Mittelstand treffen. Auch die CDU erteilt Steuererhöhungen eine Absage, sie will die Konjunktur mit anderen Mitteln ankurbeln und über das so herbeigeführte Wachstum zusätzlichen finanziellen Spielraum durch steigende Steuereinnahmen der Öffentlichen Hand schaffen.
Anhebung der Tabaksteuer
Scholz plant außerdem, die Tabaksteuer zum 1. Januar 2022 zu erhöhen. Damit will die Bundesregierung Mehreinnahmen in die Kassen spülen – kalkuliert wird grob mit rund 11,3 Milliarden Euro bis Ende 2025. Bis dahin sollen die Steuern auf Tabakwaren schrittweise jährlich erhöht werden – und zwar um jeweils fünf Cent pro Jahr für 20 Zigaretten. Parallel dazu sollen auch die Preise für Zigarillos, Zigarren und Tabak steigen. Auch E-Zigaretten sollen nach diesen Planungen erstmals besteuert werden. Und zwar solche mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten. Damit ist es aber noch nicht getan. CDU, CSU und SPD haben sich grundsätzlich darauf verständigt, auch weniger gesundheitsschädlichen Tabakprodukten die bisherige Steuerprivilegierung zu entziehen. Bei E-Zigaretten wird das Liquid nicht verbrannt, sondern nur erhitzt. Außerdem kann der Gehalt von Nikotin individuell gesteuert werden, wodurch sie im allgemeinen als gesündere Alternative zur Tabakzigarette gelten (E-Zigaretten im Test). Solche Produkte sollen künftig der regulären Besteuerung unterworfen werden. Trotz der grundsätzlichen Einigkeit der Koalitionäre in dieser Frage sind die Details der einzelnen Steuermaßnahmen noch nicht geklärt. Tatsächlich würden die angedachten Maßnahmen drastisch auf die Preise von E-Zigaretten durchschlagen. Die handelsüblichen zehn Milliliter nikotinhaltiger Flüssigkeit, zurzeit für fünf Euro zu haben, würden sich im ersten Erhöhungsschritt um vier Euro, also 80 Prozent, verteuern. Im zweiten, für 2024 geplanten Schritt könnte der Preis noch einmal kräftig anziehen. Der Steueranteil würde dann auf bis zu acht Euro steigen.
Bild 1: stock.adobe.com @ Freedomz
Bild 2: stock.adobe.com @ rogerphoto
Bild 3: stock.adobe.com @ memyjo