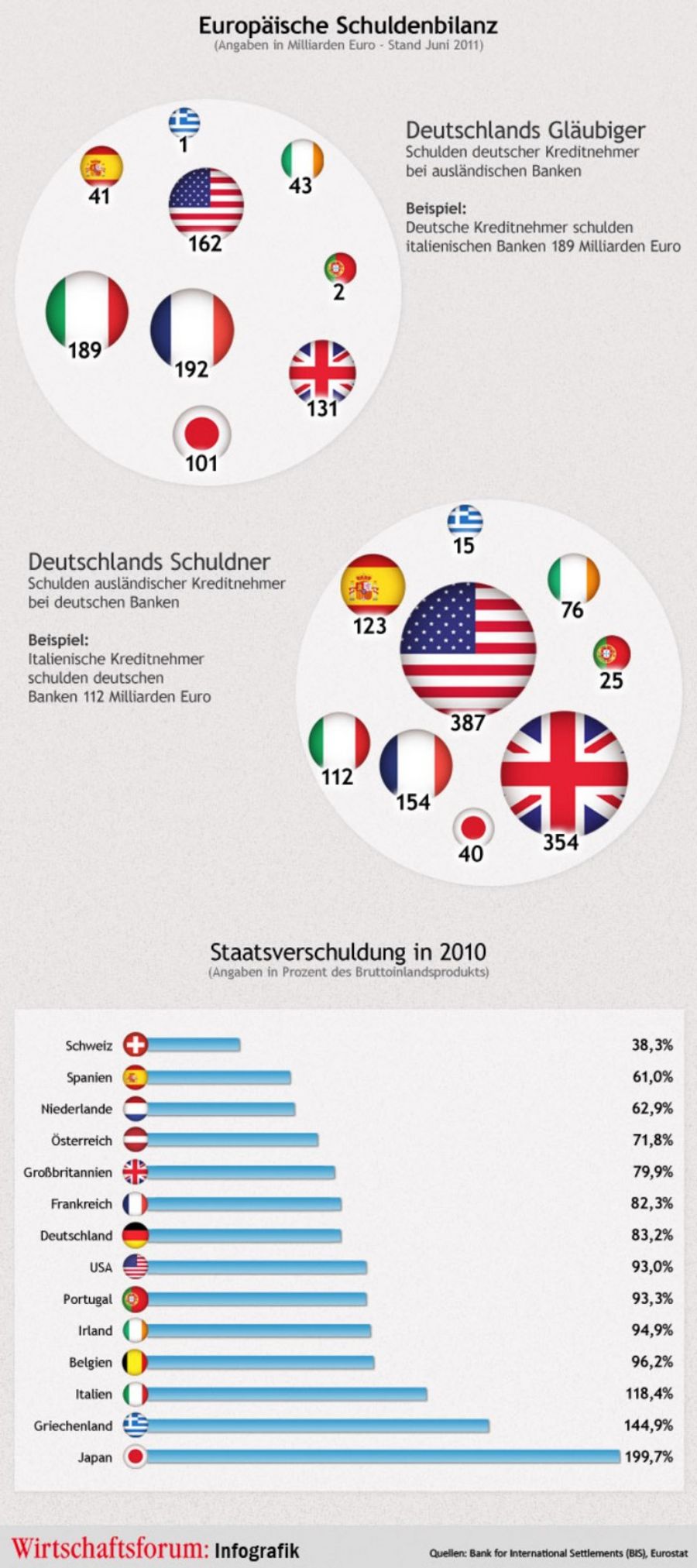Für die einen sind sie ein wirksames Medikament, um die Folgen der Schuldenkrise abzumildern, andere wiederum befürchten, dass bislang als finanziell solide eingeschätzte Staaten ebenfalls in den Sog des finanziellen Fiaskos gezogen werden könnten.
Doch worum geht es eigentlich bei den Eurobonds, auch Euro-Staatsanleihen genannt? Einfach ausgedrückt könnten sie als eine Art "Haftungsgemeinschaft" bezeichnet werden. Dabei nehmen die EU-Staaten gemeinsam Schulden an den internationalen Finanzmärkten auf und verpflichten sich dazu, ebenso gemeinschaftlich für Rückzahlung und Zinsen zu haften.
Eurobonds machen die EU gewissermaßen zu einer finanziellen Haftungsgemeinschaft. Konkret ausgedrückt übernehmen bislang als solide angesehene Euroländer wie Deutschland, Österreich, die Niederlande und Frankreich eine Art Ausfallbürgschaft für stark gefährdete EU-Mitglieder, zum Beispiel Griechenland, Italien, Portugal und Irland sowie - ganz aktuell - Belgien.
Befürworter wie Gegner von Eurobonds führen verschiedene Argumente an. Für die Europa-Anleihen spricht, dass Spekulationen gegen Staaten - die manche EU-Mitgliedsländer noch tiefer in die Krise geführt haben - zumindest teilweise erschwert werden. Länder wie Griechenland und Italien bekämen wieder Kredite zu erschwinglichen Bedingungen und könnten so ihre Haushalte mittel- bis langfristig entschulden - natürlich nur bei gleichzeitig strikter Ausgabendisziplin.
Doch gerade hier sehen Kritiker eine Gefahr. Sie befürchten, dass die teilweise Haftungsübernahme durch die wirtschaftlich soliden Länder dazu führen könnte, dass Krisenländer ihre laxe Ausgabepolitik fortsetzen. Die "Geberländer" dagegen müssten den Investoren in Eurobonds deutlich höhere Zinsen zahlen als dies bei ihren nationalen Staatsanleihen der Fall ist.