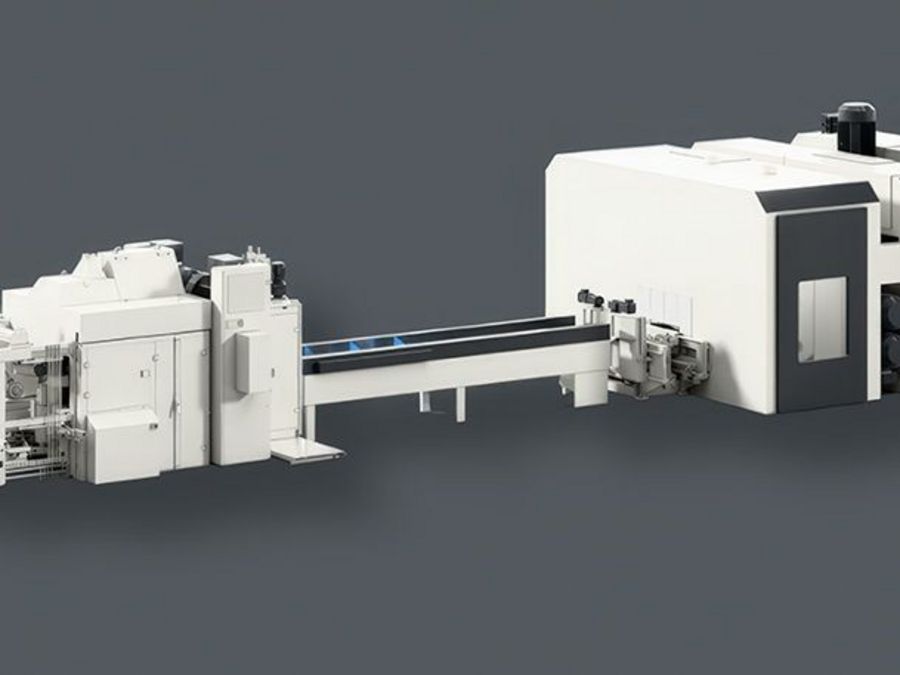E-Health: Wie weit ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen fortgeschritten?
Digitalisierung

25.11.2021
Auch in das Gesundheitswesen hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. Sie kann hier dabei helfen, die Gesundheitsversorgung weltweit erfolgreich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Doch noch ist vielen Menschen gar nicht klar, was digitale Gesundheit oder E-Health eigentlich genau umfasst. Zudem wissen die meisten nicht, dass in Deutschland schon diverse Schritte getan wurden und Möglichkeiten der digitalen Gesundheit genutzt werden können. Dennoch steht ebenfalls fest: Deutschland hinkt im internationalen Vergleich hinterher.
Was bezeichnet E-Health eigentlich genau?
Informations- und Kommunikationstechnologien verändern bereits seit Längerem auch die Gesundheitsbranche. Die Digitalisierung erfüllt hierbei keinen Selbstzweck. Vielmehr bietet sie neue Chancen, Gesundheitssysteme effizienter und wirksamer zu machen. Menschen sollen dank der Digitalisierung vor allem einen schnelleren Zugang zu Gesundheitsleistungen bekommen und diese besser nutzen können.
Hierfür gibt es diverse Möglichkeiten. Digitale Gesundheitsanwendungen fürs Smartphone oder Tablet sind ein Teil davon. Die CovPass-App, über die das digitale COVID-Zertifikat der EU abgerufen werden kann, ist das derzeit wohl bekannteste und eines der meistgenutzten Beispiele hierfür. Doch auch etwa die Möglichkeit der Videosprechstunde, für spontane „digitale Besuche bei den Ärzt:innen“ oder etwa ein Notfalldatensatz auf der elektronischen Gesundheitskarte sind weitere Möglichkeiten, die E-Health bietet.
Besonders wichtig ist bei der Digitalisierung der Gesundheitsbranche der Ausbau der Telematikinfrastruktur. In einem Interview, das wir mit Enrico Jensch, COO der Helios Kliniken GmbH, führten, wies auch er hierauf hin. Jensch betonte die Relevanz der Telemedizin, welche die Diagnostik und Therapie unter Überbrückung einer räumlichen oder zeitlichen Distanz zwischen beispielsweise Arzt und Patient bezeichnet. Genauso aber profitieren Kliniken, Apotheken und etliche andere Akteure des Gesundheitswesens von ihr.
Um sie zu vereinfachen, bedarf es eines gesteigerten Bewusstseins der Bevölkerung für die Vorteile der digitalen Medizin und ein aktives Partizipieren – etwa indem Daten in digitaler Form, statt bisher lediglich analoger Form hinterlegt werden. Sind den Menschen erst einmal die Vorteile der Digitalisierung des Gesundheitswesens bewusst, entscheiden sie sich oft ganz schnell von allein dazu, sich näher mit dem Thema zu befassen. Dann können bereits vorhandene Möglichkeiten rasch genutzt werden.
Die Vorteile der Digitalisierung des Gesundheitswesens
Die Vorteile der Digitalisierung des Gesundheitswesens dürften teilweise schon ersichtlich geworden sein. Dennoch sollen drei Beispiele noch mehr verdeutlichen, welchen konkreten Nutzen bestimmte Innovationen haben und warum man auf sie in Zukunft vermutlich kaum noch verzichten können wird.
1. Wie bereits erwähnt, ist heute die oftmals vorhandene Distanz von etwa Patient:in und Therapeut:in ein großes Problem. Geräte und digitale Innovationen, die der Fernüberwachung dienen, lassen dieses Problem geringer werden. Man denke hier beispielsweise an die digitale Kardiologie- und Herzschrittmacher-Kontrolle. Derlei digitale Möglichkeiten helfen schon heute dabei, dass Menschen zum einen besser selbst auf ihre Gesundheit achten können. Dadurch entlasten sie zudem die Gesundheitssysteme. Zum anderen sind bei akuten Nachfragen oder Probleme Ärzt:innen schneller genau informiert.
Genauso spannend sind Remote Patient Monitoring Systeme (RPM).
Sie ermöglichen es, den Zustand von Risikogruppen, Infizierten und Erkrankten an COVID-19 auch von der Ferne aus zu begleiten und zu kontrollieren. Eine App sowie bei Pflegebedürftigen ein Telefonserver ermöglichen eine medizinische Kontrolle dieser Art.
Diverse Parameter, wie der Puls, die Atemfrequenz, die Körpertemperatur oder einfach der Allgemeinzustand und die Sauerstoffsättigung werden dabei erhoben. Das Gesundheitsamt oder betreuende Ärzt:innen haben Zugriff auf diese Daten auf einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, dass Datenschutz jederzeit gewahrt wird.
Menschen, die vielleicht eher in dörflichen Regionen leben, in denen sie nicht so schnell medizinische Versorgung finden, profitieren ebenfalls von Fernüberwachung und Informations- und Kommunikationstechnologien. Sie helfen somit förmlich dabei, gesundheitliche Ungleichheiten abzubauen.
2. Anhand des in Deutschland bereits seit 1. Juli 2021 von einigen Ärzt:innen ausgestellten E-Rezepts lässt sich gut zeigen, wie simpel und effektiv digitale Lösungen im Gesundheitswesen sind. Ab 1. Januar 2022 wird das E-Rezept deutschlandweit übrigens verpflichtend eingeführt. Bereits jetzt lohnt es sich bei Interesse aber Hausärztin oder Hausarzt danach zu fragen. Mitunter können sie das E-Rezept schon jetzt digital erstellen.
Das elektronische Rezept kann also das bisherige Rezept in Papierform ersetzen. Man muss sich das E-Rezept dabei als eine Art Nachricht vorstellen, die zwischen den Patient:innen und Arztpraxen, Versicherungen sowie Apotheken gesendet werden kann. Behandelte Ärzt:innen erstellen ein entsprechendes Rezept digital und pflegen es in eine Datenbank ein. Hier wird es verschlüsselt und kann nur von den Patient:innen mit einem Code abgerufen werden. Je nachdem, an welche Apotheke – egal ob stationär oder online – die Patient:innen das Rezept weitergeben möchten, können sie dieses dann wiederum gezielt weiterschicken.
Dabei vereinfacht das E-Rezept massiv die Kommunikation zwischen Patient:innen, Ärzt:innen und Apotheken, sodass Medikamente schneller und einfacher zu den Betroffenen finden. Auch lassen sich beispielsweise Folgerezepte ohne großen Aufwand nachbestellen. Krankenkassen wiederum sparen sich Zeit und Personale bei der Rezept-Abrechnung, was sich am Ende des Tages sogar positiv auf die Beiträge und somit alle Krankenkassenpatient:innen auswirken kann.
3. Die Künstliche Intelligenz ist schließlich ein weiteres gutes Beispiel für die Vorteile der Digitalisierung des Gesundheitswesens. So sind künstliche Intelligenzen heute schon in der Lage, Krankheiten wie Hautkrebs frühzeitig zu erkennen. Auf Basis eines riesigen Datenpools und Abgleichs mit ähnlichen Werten, Abbildungen und Merkmalen, können Programme Muttermale gründlicher untersuchen als menschliche Ärzt:innen.
Zudem ist die KI in der Lage, die Veranlagung für gewissen Krankheiten umfassend zu treffen. Auch hier ist menschliches Arztpersonal der digitalen Technologie in der Regel unterlegen. Das bedeutet natürlich nicht, dass zweiteres ersetzbar wird. Die menschliche Komponente ist sowohl bei der Diagnose als auch der Therapie weiterhin unabdingbar. Denn Maschinen können nicht die emotionale Komponente und seelische Unterstützung bieten wie ein Mensch das kann. Außerdem sind Ärzt:innen in der Lage, komplexe Fragen zu beantworten auf die eine KI heute mitunter (noch) keine Antwort hat.
E-Health im internationalen Vergleich
Die Bertelsmann Stiftung mit Sitz in Gütersloh hat auf Grundlage von 34 Indikatoren zu Strategie, technischer Readiness, digitalem Reifegrad und tatsächlichem vernetzten Gesundheitsdatenaustausch 17 Länder weltweit verglichen und bewertet. Die Ergebnisse, so heißt es auf der Website der Stiftung, „können und sollen in ihrer Überleitung zu Handlungsempfehlungen Impulse geben, wie die Digitalisierung des Gesundheitswesens auch hierzulande vorangetrieben werden kann.“
Dabei wurden zunächst wichtige Eckdaten der jeweiligen Gesundheitssysteme der 17 Länder erfasst. Basierend auf einer Literaturrecherche wurden außerdem die Aktivitäten und Entwicklungen im Bereich E-Health der vergangenen fünf bis zehn Jahre umrissen. Die fünf Länder, die am besten abschnitten, waren in, was den Digital-Health-Index betrifft, absteigender Reihenfolge: Estland, Kanada, Dänemark, Israel und Spanien. Am schlechtesten schnitten in absteigender Reihenfolge ab: Belgien, Schweiz, Frankreich, Deutschland und schließlich Polen.
Warum Deutschland nur auf dem vorletzten Platz landete, soll an späterer Stelle erläutert werden. Zunächst einmal dürfte es spannend sein, zu schauen, was die Spitzenplätze der Studie besser machen und warum sie so gute Ergebnisse bekamen. Wir wollen uns dabei auf die beiden führenden Länder Estland und Kanada konzentrieren.
Estland
– Das wichtigste Element der Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Gesundheit ist in Estland das sogenannte ENHIS. Dieses Gesundheitsinformationsaustauschnetzwerk ist landesweit ausgebaut. Das ENHIS registriert im Grunde genommen die gesamte Krankengeschichte der Bevölkerung von der Geburt bis hin zum Tod. Alle Ärzt:innen, Fachärzt:innen, Krankenhäuser und Apotheken des Landes sind heute bereits an ENHIS angeschlossen. Zwar können theoretisch alle Ärzt:innen auf die Patient:innendaten zugreifen. Die Patient:innen bleiben aber selbstverständlich Eigentümer:innen aller Daten und können die Weitergabe somit voll kontrollieren. Nur, wenn die gesamten oder ausgewählte elektronische Akten im ENHIS zugänglich gemacht werden, können entsprechend befugte Personen diese einsehen.
– Neben der direkten Nutzung rund um die eigene Gesundheit, ist über ENHIS zudem die sekundäre Nutzung von Gesundheitsdaten möglich. Das bedeutet, dass Patient:innen ihre Daten freiwillig für wissenschaftliche Untersuchungen oder Statistiken freigeben können. Dadurch lässt sich das Gesundheitssystem gegebenenfalls weiter ausbauen und effizienter gestalten.
– Projekte im Bereich der digitalen Gesundheit werden in Estland schon seit dem Jahr 2004 vom Wirtschaftsministerium finanziert. Im Jahr 2005 wurde die Estonian eHealth Foundation gegründet. Sie kümmert sich seit diesem Jahr um jegliche Digital-Health-Angelegenheiten zuständig. 2017 fusionierte die sie außerdem mit dem E-Service-Referat des Ministeriums für Soziale Angelegenheit zum Zentrum für Gesundheits- und Sozialinformationssysteme TEHIK. Das TEHIK entwickelt Digital-Health-Dienste und stellt IKT-Dienste bereit. Es dient somit als Schnittstelle für die digitale Gesundheit.
– Das E-Rezept kann in Estland bereits seit 2018 in jeder Apotheke eingelöst werden. Auch die technische Abdeckung anderer digitaler Dienste, wie der elektronischen Patientenaktie (ePA) ist bereits zu 100 Prozent umgesetzt.
– Möchten Patient:innen ihre Hausärzt:innen konsultieren, ist dies in Estland per Video jederzeit möglich. Zudem sind elektronische Terminbuchungen routinemäßig möglich.
Kanada
– Bereits im Jahr 2001 wurde in Kanada die öffentliche Gesellschaft „Canada Health Infoway“ (Infoway) gegründet. Die hauptsächlichen Aufgaben der Non-Profit-Organisation waren und sind immer noch (mit Verlagerung der Schwerpunkte aufgrund der Erfolge) die Einführung einer interoperablen elektronischen Patientenakte (ePA) sowie die Förderung und Beschleunigung weiterer digitaler Gesundheitsdienste.
– Mehr als zwei Milliarden kanadische Dollar investierte die Regierung Kanadas inzwischen in Infoway.
– Infoway arbeitet beispielsweise mit den Provinzen und privatwirtschaftlichen Akteur:innen zusammen, um den nationalen E-Rezept-Dienst PrescribeIT landesweit aufzubauen. Über diesen Dienst können Ärzt:innen E-Rezepte an eine Apotheke schicken, die Patient:innen individuell vorher für sich ausgesucht haben. 2018 waren bereits 3400 Apotheken in sechs Provinzen an PrescribelIT angeschlossen.
– Ferndiagnosen und Fernbehandlungen per Video sind in etlichen Provinzen ebenfalls bereits ein selbstverständlicher Teil der medizinischen Versorgung.
– Der E-Rezept-Dienst kann in Kanada überregional genutzt werden.
– ePAs und Gesundheitsportale sind in den Provinzen weitgehend etabliert und Telemedizinprogramme je nach Provinz unterschiedlich verfügbar.
Aktuelle Entwicklungen
Woche für Woche tun sich weltweit in diversen Ländern neue Türen auf, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben. Oft allerdings geht es dabei eher schleppend voran. Gute Neuigkeiten aber gab es kürzlich erst für den Westbalkan. Für die Nachfolgestaaten Jugoslawiens und Albaniens, also in Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Albanien und Nordmazedonien gründete die WHO/Europa unlängst ein Netzwerk für digitale Gesundheit.
Die Regierungen haben inzwischen verinnerlicht, dass es enorm wichtig ist, moderne Methoden und Technologien der primären Gesundheitsversorgung in die nationalen Gesundheitssysteme zu integrieren. Allerdings ist der Mangel an Handlungskonzepten und eine entsprechende Lenkung der Politik noch groß. Auch digitale Kenntnisse und Fachkräfte im allgemeinen Gesundheitsbereich sind noch zu rar gesät, um die digitale Gesundheit so zu etablieren, wie man sich das wünschen würde.
Das Netzwerk soll nun die Arbeit und die Verpflichtungen rund um die digitale Gesundheit, die ein wegweisender Fahrplan vorgibt, effektiv unterstützen. Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, wies auch in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Corona-Pandemie hin und erklärte:
„COVID-19 war ein Weckruf und hat die Notwendigkeit unterstrichen, die Anwendung digitaler Technologien im öffentlichen Gesundheitswesen und in der Gesundheitsversorgung voranzutreiben. […] Durch die Pandemie hat sich eine Dynamik entwickelt, die wir jetzt nutzen müssen, um ressort- und grenzübergreifend zu gewährleisten, dass die digitale Umgestaltung das Versprechen sicherer, wirksamer und chancengleicher digitaler Gesundheitsangebote in der Zeit nach COVID-19 einlöst.“
Deutschland und die digitale Gesundheit
Obwohl wir zwar mit dem Thema E-Health in Deutschland hinterherhinken, tut sich selbst hier nach und nach immer mehr. Zwar lässt sich der Ausbau der Möglichkeiten, die die digitale Gesundheit bietet, noch immer nicht mit anderen europäischen Ländern vergleichen. Doch immerhin gibt es auch hier inzwischen mehr als nur die CovPass-App.
Was ist hierzulande bereits möglich?
Eine der derzeit wichtigsten Möglichkeiten der digitalen Gesundheit, die teilweise schon eingesetzt wird, ist das bereits erwähnte E-Rezept. Das es ab dem 1. Januar 2022 als verschreibungspflichtiges Arzneimittel verpflichtend eingeführt werden soll, dürfte es schon bald ein ganz selbstverständlicher Teil des Versorgungsalltags sein. Doch es gibt noch eine Reihe weiterer digitaler Leistungen und Anwendungen im medizinischen Bereich, die bereits seit Längerem in Deutschland verfügbar sind und die Patient:innen nutzen können und zukünftig sicherlich nutzen werden.
• Zum 1. Januar 2021 wurde die ePA, die elektronische Patientenakte, eingeführt. Nach einer Testphase soll sie bald vollumfänglich zur Verfügung stehen. Die Krankenkassen sind daher dazu verpflichtet, den Versicherten eine ePA in mehreren Ausbaustufen zur Verfügung zu stellen. Anfangs lassen sich wichtige Daten aus bereits vorhandenen Anwendungen und Dokumentationen in der ePA speichern. Das sind beispielsweise Notfalldaten und ein Medikationsplan. Patient:innen können die behandelnden Ärzt:innen damit zur Verbesserung der medizinischen Behandlungsqualität über besagte wichtigen Gesundheitsdaten informieren.
Mit der Zeit können Patient:innen eigene Informationen, wie Blutzuckermessungen und Ähnliches hinterlegen. Andere wichtige Informationen zur Krankengeschichte werden schließlich ebenfalls gespeichert. Seien dies etwa Medikamente, Röntgenbilder oder Übersichten zu eventuellen früheren Erkrankungen – all das findet sich in der ePA wieder. Dabei können behandelnde Ärzt:innen oder gegebenenfalls Apotheker:innen die Daten stets nur nach einer Einwilligung durch die Eigentümer:innen der Daten abrufen. Außerdem bleibt die Nutzung der ePA freiwillig.
• Schon seit 2019 ist in Deutschland etwa für Hausärzt:innen, Fachärzt:innen und Psychotherapeut:innen eine Videosprechstunde möglich. Hierbei lassen sich die entsprechenden Expert:innen online konsultieren und Patient:innen können dabei den gleichen Service erwarten, wie vor Ort.
Zudem ergeben sich Vorteile: Die Patient:innen ersparen sich eventuell beschwerliche Anfahrten, was gerade für ältere Menschen ein großer Vorteil sein kann. Außerdem wird das Risiko minimiert, dass sich bei einem Besuch vor Ort andere mit Krankheitserregern anstecken oder das man sich selbst etwas anderes einfängt.
• Seit dem 01.10.2021 haben Arztpraxen die Möglichkeit, die Krankschreibung für die Krankenkasse direkt und digital zu übermitteln. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ersetzt damit einen postalischen Versand des bisherig gängigen gelben Papierdurchschlags an die Krankenversicherung.
Die Patient:innen können sich jedoch weiterhin eine Papierbescheinigung zur persönlichen Dokumentation und als Nachweis ausstellen lassen.
Warum geht es mit der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens so schleppend voran?
Die elektronische Patientenakte, eine Patientenkurzakte mit einem Basisdatensatz für Notfälle, die elektronische Medikationsliste, das E-Rezept sowie das Gesundheitsinformationsportal gibt es nun schon seit einiger Zeit in Deutschland. Wie kommt es, dass es grundsätzlich mit der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens aber so schleppend vorangeht?
Zum einen ist keine der oben genannten, digitalen Anwendungen zum jetzigen Zeitpunkt (November 2021) national umgesetzt. Das hat damit zu tun, dass es in Deutschland erst seit knapp fünf Jahren einen formalen Fahrplan für den Ausbau von E-Health gibt. Das E-Health-Gesetz ist sinnvoll, es mangelt jedoch weiterhin an einer nationalen Digital-Health-Strategie, die verbindliche Ziele und Richtlinien vorgibt.
Im E-Health-Gesetz finden sich beispielsweise nur Regelungen für vereinzelte Anwendungen. Deutlich mehr Sinn würde es mit Sicherheit ergeben, wenn sich eine bestimmte Institution um die Koordination der Digitalisierung des Gesundheitswesens kümmern würde. Bislang allerdings delegiert man lieber Kompetenzen und Entscheidungen auf Bundesebene an die Länder und an die gemeinsame Selbstverwaltung.
Zum anderen steht bis heute kein gesondertes Budget für nationale Digital-Health-Projekte zur Verfügung. Auf Länderebene gibt es ebenfalls nur begrenzte Geldmittel für E-Health-Initiativen, die sich produktiv nutzen lassen.
Was halten die Deutschen von E-Health?
Dem Fortschritt der digitalen Gesundheit in Deutschland tun letztlich natürlich alle Bürger:innen einen Gefallen, die sich dem Thema öffnen und bereits gegebene Möglichkeiten nutzen. Auskunft darüber, wie die Deutschen E-Health gegenüber eingestellt sind, gibt etwa der „Healthcare-Barometer 2020“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaf PwC.
Für die Studie wurden 1.000 Deutsche mit einem Mindestalter von 18 Jahren repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Region online befragt. Die Ergebnisse stimmen positiv. Denn E-Health wird von den meisten Deutschen offensichtlich begrüßt, was gute Nachrichten für die Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems sind.
So waren 80 Prozent der Befragten etwa der Meinung, dass die Fortführung des Innovationsfonds, der die integrierte Versorgung und Versorgungsforschung in Deutschland fördern soll, etwas Gutes sei. Für die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen waren 77 Prozent und die Möglichkeit, Gesundheitsapps auf Rezept zu bekommen, hielten 74 Prozent für sinnvoll. Wenn es um die Online-Versorgungspraxis geht, ist der Großteil der Befragten ebenso aufgeschlossen. So würden ganze 76 Prozent das E-Rezept nutzen und immerhin 54 Prozent die Videosprechstunde. Ganze 87 Prozent gaben zudem an, dass sie die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per Internet nutzen würden.
Wichtig bleibt den Deutschen bei alldem aber selbstverständlich die Datensicherheit. Ganze 93 Prozent der Befragten waren so der Meinung, dass ohne ausdrückliche Zustimmung der Krankenversicherten keine Weiterhabe von Daten stattfinden darf. Da das Bundesministerium selbst immer wieder betont, wie wichtig es ist, den Datenschutz hochzuhalten, dürfte eine Weitergabe sensibler Daten ohne Zustimmung aber sowieso prinzipiell ausgeschlossen sein. Das weiß auch die Mehrheit der Deutschen: 66 Prozent sind sicher, dass die Datensicherheit im Rahmen des Digitalen Versorgungsgesetzes (DVG) gründlich geprüft wird und deshalb gewährleistet werden kann.